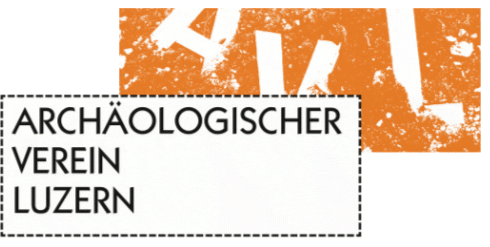von AVL | 5. Februar 2026
Mittwoch, 11. März 2026, 19.00 Uhr, Luzern, Mittelschulzentrum, Hirschengraben 11, Hörsaal, 3. OG
mit anschliessendem öffentlichen Vortrag um 20 Uhr „Hügelgräber und Hausgeschichten – Ein Blick auf das archäologische Jahr 2025 im Kanton Luzern„ von Dr. Christian Auf der Maur, Kantonsarchäologe Luzern
Wir laden alle Mitglieder herzlich zu unserer Jubiläums-Generalversammlung ein.
Zum nachfolgenden Vortrag des Luzerners Kantonsarchäologen , Dr. Christian Auf der Maur, sind auch weitere Gäste herzlich willkommen: 2025 war archäologisch ein vielseitiges und herausforderndes Jahr im Kanton Luzern. Die wachsende Anzahl Feldinterventionen ergaben einige Überraschungen, sei es unter Parkplätzen, in Leitungsgräben, im See oder in Gebäuden. Ein Highlight war die Rettungsgrabung eines bronzezeitlichen Hügelgrabes mit ungestörtem Körpergrab in Dagmersellen Buchs-Grundwald. Unerfreulich hingegen ist die Erkenntnis, dass die ältesten Bauten in den Seeufersiedlungen schlecht erhalten sind. Die 2025 durchgeführte Pilot-Analyse bestätigt demnach die Vermutung der Kantonsarchäologie. Für das laufende und die kommenden Jahre sind dementsprechend richtungsweisende und spannende Projekte in Aussicht.
von AVL | 18. Dezember 2025
Mittwoch 14. Januar 2026, 20.00 Uhr, Öffentlicher Vortrag
Hörsaal 307, Mittelschulzentrum am Hirschengraben 10, Luzern (Lift zugänglich ab 19:45 Uhr)
Als 1991 die Ausgrabung beim heutigen Hotel Hofgarten an der Luzerner Stadthofstrasse in Angriff genommen wurde, ahnte noch niemand, dass sie eine der bedeutendsten Entdeckungen zum spätmittelalterlichen Töpferhandwerk der Schweiz liefern würde: Unglaubliche 58’000 Scherben von Ofen- und Geschirrkeramik konnten geborgen werden. Sie stammen aus der Abfallhalde einer Hafnerwerkstatt der Zeit zwischen 1380 und 1420.
Über dreissig Jahre nach der Grabung können diese einzigartigen Funde nun endlich wissenschaftlich untersucht und publiziert werden. Die Keramikexperten Eva Roth Heege und Andreas Heege sind ausgewiesene Meister ihres Fachs und werden uns einen faszinierenden Einblick in das mittelalterliche Handwerk, die Arbeitsweise und die Produktepalette dieser Luzerner Hafnerei geben.
von AVL | 4. Oktober 2025
Öffentlicher Vortrag, Mittwoch 12. November 2025, 20 Uhr
Achtung! Neuer Ort: Luzern, Mittelschulzentrum am Hirschengraben 10, Hörsaal 307
Herbstvortrag von Dr. phil. Hannes Flück – Archäologe und Co-Leiter des interdisziplinären Forschungsprojekt CVMBAT
Die Uni Basel und der Archäologische Dienst Graubünden führen seit 2021 ein Forschungsprojekt im Surses, zwischen Tiefencastel und dem Septimerpass durch. Die systematische Begehung des Geländes mit Metalldetektoren unter Mithilfe zahlreicher Freiwilliger förderte ein umfangreiches Fundensemble zu Tage, das eindeutig ein Kampfgeschehen in der Zeit kurz vor Christi Geburt belegt. Es handelt sich um das einzige bisher sicher nachgewiesene römische Gefechtsfeld in der Schweiz. Dank der Neuvermessung der Geländeoberfläche konnte zudem auf einer Höhe von 2200 m ü. M. ein kleines Militärlager entdeckt und in den letzten beiden Sommern untersucht werden. Zusammen mit den Funden vom Gefechtsfeld sowie weiteren Fundstellen und Funden u. a. von der Passhöhe des Septimerpasses erlaubt dies, eine römische Militäreinheit über eine Distanz von 70 km gesichert zu verfolgen. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden zudem experimentell-archäologische Projekte zum Schiessen mit Schleuderbleien oder zum Verschieben der Truppe mit Maultieren im alpinen Gelände gemacht.
Öffentlicher Vortrag – Gäste sind herzlich willkommen!
von AVL | 1. Juni 2025
Samstag, 23. August, Sommerexkursion
Olten ist mehr als nur ein Bahnhof! Eine menschliche Präsenz in der Region ist seit der Altsteinzeit belegt. In der Jungsteinzeit wurde der lokal anstehende Silex (Feuerstein) abgebaut und weit herum verhandelt. Zur Zeit der Römer bestand im Bereich der heutigen Altstadt eine stattliche Siedlung (vicus), welche vermutlich in der zweiten Hälfte des 3. Jh. n. Chr. zerstört wurde. Im 4. Jh. n. Chr. wurde der Übergang zur Aare befestigt und ein Kastell erstellt.
Die mittelalterliche Stadt (1201 erstmals erwähnt) wurde auf den Grundmauern des römischen Kastells erbaut. Sie blieb bis zum Bau der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts ein beschaulicher Brückenort. Heute ist Olten ein Knotenpunkt mit einem der zehn meist frequentierten Bahnhöfe der Schweiz.
Am Vormittag werden wir durch die Altstadt geführt und deren archäologische Fundstellen kennenlernen. Nach dem Mittagessen besuchen wir das Haus der Museen, wo wir unter anderem eine Führung durch die archäologische Sammlung erhalten, aber auch die übrigen Ausstellungen erkunden können.
Details finden Sie in der Einladung.
von AVL | 17. April 2025
Samstagmorgen, 17. Mai 2025, im Museum für Urgeschichte(n), Zug
Was braucht es, damit die Menschen in einem jungsteinzeitlichen Dorf gut auf den Winter vorbereitet sind? In einem Spiel bildet Ihr eine jungsteinzeitliche Dorfgemeinschaft. In kleinen Gruppen löst Ihr Aufgaben in der Ausstellung und erspielt Euch so wertvolle Vorräte und Rohstoffe für den Winter. Dabei gilt es auch Schwierigkeiten wie Hagelstürme, Krankheiten oder Schädlinge im Vorratstopf zu überwinden. Schafft Ihr es, vor Wintereinbruch genügend Vorräte zu sammeln? Kurze Inputs zur Archäologie der Jungsteinzeit runden das Erlebnis ab.
Geeignet für Kinder und Jugendliche ab dem Primarschulalter. Die Kinder können idealerweise kurze Texte selber lesen und verstehen. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen! Infos und Anmeldung unter info@avlu.ch (Anmeldeschluss 02.05.2025).
Die Kosten werden vom AVL mit Ausnahme des Zugbilletts übernommen.